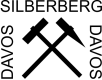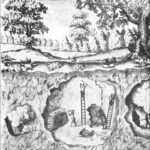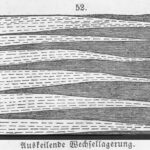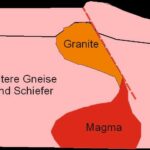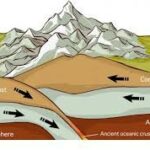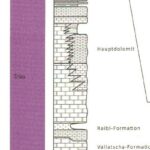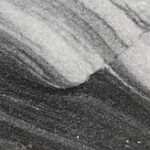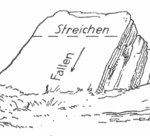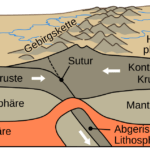Begriffe Bergbau
Die nachfolgende Begriffsauflistung ist auf die Homepage ausgerichtet und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Abraum: Nicht verwertbares Gestein wird Übertag auf Abraumhalden oder im Stollen im Versatz auf Bühnen geschüttet
Abteufung: Vortrieb in die Tiefe
Anfahren: Sich zu Fuss oder mit einem Gefährt zum Arbeitsplatz in die Grube begeben
Auffahren: Herstellen eines horizontalen oder geneigten Grubenraums
Aufschlagwasser: Das zum Antrieb auf das oberschlächtige Wasserrad fliessende Wasser
Aufwältigen: Wiederbenutzbarmachen eines verbrochenen oder verfüllten Grubenbaus
Ausbeute: a) Abbauen von Erzlagerstätten und b) Gewinn einer Grube nach Abzug aller Unkosten
Ausbiss: Der an der Erdoberfläche sichtbare Teil einer Lagerstätte
Berge: Taubes, nicht nutzbares Gestein, das in der Grube vom Erz getrennt im Versatz auf Bühnen deponiert wurde
Bergtrog: Eimer für taubes Material
Bulge: Grosser Wassersack aus 2 Stierhäuten gefertigt; wird an den Haken der Zugkette gehängt, um Wasser aus dem Schacht zu heben
Doppelhäuer (Vollhäuer): Voll ausgebildeter Häuer (Bergknappe)
Einfahren: Sich in eine Grube begeben
Erbstollen oder Wasserlöserstollen: Wird auf dem tiefst möglichen Niveau zur Entwässerung eines Stollensystems angelegt
Erzgang: Gesteinsspaltenfüllung durch metallhaltige Minerale, oft kurz Gang genannt
Fahren: Sich unter Tage fortbewegen
Fahrkunst: Im Schacht maschinell auf und nieder bewegtes, mit Trittflächen versehenes Gestänge (meist doppelt) zum Ein- und Ausfahren der Bergleute (19. Jh.)
Fahrschacht: Geneigter Grubenbau für den Zutritt zu einem Bergwerk oder Stollen
Fahrte: Leiter
Fahrt: Grubenfahrt
Feldort: Ein zur Untersuchung unbekannter Teile der Lagerstätte oder des Gebirges vorgetriebener Ort (Suchstollen)
Feuersetzen: Bis Anfang 19. Jh. gebräuchliche Methode zum Lösen von Gestein durch Erhitzen; infolge der schlechten Wärmeleitfähigkeit entstehen Spannungsrisse und damit eine Auflockerung des Gesteinsverbands (Balthasar Rösler – Balthasar Rösler (1700): „Speculum metallurgiae politissimum“, Hellpolierter Bergbau-Spiegel, Dresden)
Firstenbau: Abbau von unten nach oben
Fundgrube: Grubenfeld das sich unmittelbar auf der Fundstelle eines neuen Erzganges befand
Gedinghäuer: Häuer der im Akkord eine bestimmte Arbeit verrichtet
Gerinne: Wasserleitung um das zufliessende (Aufschlag-) und das wegfliessende (Abschlag-) Wasser zu kanalisieren
Gesenke: Ein von oben nach unten abgeteufter Blindschacht
Gewältigen: Herausschaffen, entleeren (Flüssiges oder Festes)
Gewerke: Mitglied einer bergrechtlichen Gewerkschaft und Besitzer von Kuxen (Anteilen) dieser Gesellschaft; es hatte Anrecht auf die Ausbeute, war aber verpflichtet Zubusse zu leisten, falls die Gewerkschaft weitere Geldmittel benötigte
Gezeugstrecke: Abbaustrecke die parallel und 20 Lachter (~ 40 m) unter einem Stollen liegt; auch Mass für die Teufe eines Schachtes
Glück auf: Bergmannsgruß, wahrscheinlich seit 1650 im Erzgebirge gebräuchlich; Bedeutung: a) es mögen sich Erzgänge auftun, b) der Grubenraum möge offenbleiben, c) eine gute Grubenfahrt und glückliche Rückkehr
Grubenbau: Zum Zwecke einer bergbaulichen Nutzung hergestellter Hohlraum
Göpel: Zur Schachtförderung dienendes, im 18. und 19. Jahrhundert von Menschen, Tieren, Wasser oder Dampf angetriebenes Fördergerät mit stehender Welle und Seilkorb zur Förderung von Erz oder Grubenwasser
Häuer: Bergleute die das Lostrennen (Hereinbrechen) und Gewinnen von Erz verrichten (Bergknappe)
Heinzenkunst: Auch Taschen- Püschel- oder Paternosterkunst. Vorrichtung zum Heben von Wasser. Mit Stroh oder Reisig gefüllte Lederbälge (Bälle, ‹Taschen›, ‹Püschel›) wurden an einer endlosen Kette durch einen senkrecht im Wasser stehenden Teuchel gezogen und so Wasser von einem tieferen auf ein höheres Niveau gepumpt
Haspler: Bergmann welcher am Schacht die Seilwinde, den Handhaspel, betätigt
Haufwerk: Aus dem Gebirgsverband gelöstes Gestein
Helm: Gezähe Stiel
Herrenhäuer oder Herrenarbeiter: Werden von den Gewerken direkt entlöhnt
Huthaus: Gebäude in dem sich die Bergleute versammeln, Andacht halten, das Gezähe und andere Gerätschaft aufbewahren
Klafter: Raum- und Längenmass entspricht in etwa dem Lachter (~ 2 m)
Kunstgezeug: Einrichtung zum Heben von Wasser oder Fördergut
Kunstschacht: Förderschacht oder Pumpenschacht
Kutten: Auslesen, aussondern, umgraben
Kux: (der) Besitzanteil der Gewerken an einer bergrechtlichen Gewerkschaft; der auf die Kuxen verteilte Gewinn heisst Ausbeute, der zu tragende „Verlust“ Zubusse
Lachter: Altes Längenmass im Bergbau, je nach Region unterschiedliches Mass (~ 2 m)
Lagerstätte: Begrenzter Abschnitt der Erdkruste in dem natürliche Konzentrationen von Bodenschätzen vorhanden sind, deren Gewinnung wirtschaftlichen Nutzen bringt
Lehnhäuer: Knappe der alleine oder mit andern ein Lehen bearbeitet
Liderung: Dichtung (z.B. für Pumpen)
Markscheider: Bergbeamter der alle in einem Bergbaubetrieb anfallenden Vermessungsarbeiten ausführt und für diese verantwortlich ist
Mundloch: Eingang vom Tag aus in einen Stollen
Querschlag: Strecke quer zum Streichen der Gebirgsschichten, d. h. quer durch die Schichten
Radstube: Meist untertägiger Grubenraum in welchem ein mit Wasserkraft angetriebenes Kunst- oder Kehrrad zur Geseinsförderung oder Wasserhebung aus tieferen Grubenbauen aufgestellt war
Regal: Dem Landesherrn vorbehaltenes Recht, Bodenschätze abzubauen (Bergregal)
Saiger: Senkrecht
Saigern: Metallveredlungsverfahren mit welchem bsp. aus silberhaltigem Kupfer, Silber durch flüssiges Blei herausgelöst wird. Das stark silberhaltige Blei wird anschliessend oxidiert (Bleiglätte). Im Treibofen bleibt das Silber als «Blicksilber» zurück
Sargdeckel: Gesteinsblöcke die infolge sich kreuzender Klüftung des Hangenden spontan aus dem Schichtverband herausfallen und dadurch schwere Unfälle verursachen können
Satz: Ein Teil einer maschinell betriebenen Pumpe
Schiessen: Sprengen
Schlägel und Eisen: Gezäh des Häuers zum Lösen von Gestein vor Einführung der Sprengarbeit
Schlich: Erz aus nasser Aufbereitung auch Schleiferschlamm
Schrapper: Gefäss welches an einem Seil über den Boden gezogen wird, um Material aufzunehmen und zu verschieben
Sichen: Sieben
Sohlig: horizontal, waagrecht
Ster: Hohlmass (meist für Korn) zwischen 20 l und 30 l
Steiger: Aufsichtsperson im Bergbau
Stollen: Von der Tagesoberfläche in einen Berghang vorgetriebener, horizontaler oder schwach geneigter Grubenbau
Strecke: Ein waagrechter Grubenbau, welcher nicht zutage mündet
Tagbau: Abbau von der Erdoberfläche in die Tiefe des Gesteins
Teufe: Bergmännischer Ausdruck für Tiefe
Tonnlägiger Schacht: Ein meist dem Schichteneinfallen folgender Schacht
Treibschacht: Ist die Verbindung zwischen Über- und Untertag
Trum: Aufteilung des Querschnitts von Grubenbauen, speziell in Schächten, in mehrere Teile für bestimmte Zwecke (Fahr-, Förder-, Pumpen-, Rohr-, Wettertrum)
Ulme: Seitliche Begrenzungsfläche, Seitenwand eines Stollens
Verhauen: Abbauen bzw. abgebaut
Verhüttung: Zweite Stufe der Verarbeitung von aufbereiteten, d.h. angereicherten Erze durch Zufuhr von Wärmeenergie und fallweise unter Einsatz von Hilfsstoffen (Reduktions- oder Flussmittel) werden die reinen Metalle ausgeschmolzen
Versatz: Das ausgebrochene, taube Gestein (Berge), welches im Grubenraum wieder eingebracht wird, um den ausgebrochenen Hohlraum zu verfüllen und um so den Stolleneinsturz zu verhindern
Versturz: Spontaner Niederbruch von Gestein im Stollen
Vorgesümpfe: Tiefste Stelle einer Abteufung, wo sich das zudringende Wasser sammelt und ausgepumpt werden kann
Vortrieb: Herstellung einer Strecke im anstehenden Gestein
Wetter: Luft (Bewetterung, Belüftung der Gruben)
Zubusse: Gewerken von Gruben waren zur Entrichtung von Nachzahlungen in unbegrenzter Höhe verpflichtet, um den Weiterbestand der Gewerkschaft zu sichern
Begriffe Geologie / Mineralogie
Die nachfolgende Begriffsauflistung ist auf die Homepage ausgerichtet und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Anisien: Geologischer Zeitabschnitt der Trias vor 245 Millionen Jahren, in welchem der am Silberberg erzführende Trochitendolomit im Tethys Meer abgelagert wurde
Calcit: (Kalkspat) gesteinsbildendes Mineral, Calciumkarbonat, chemisch CaCO3, weist die größte Vielfalt an Kristallformen und Farben aller Mineralien auf; ist primär in Kalkstein und Marmor auftretend, daneben in Korallenriffen, in Sinter Bildungen (Kalktuff) oder Tropfsteinen (Stalagmiten und Stalaktiten)
Cerussit: Bleimineral, auch ,,Weissbleierz» genannt, chemisch Bleikarbonat PbCO3
Epigenetisch: Beschreibt die Entstehung von Merkmalen, bsp. von Vererzungen, die später als ihr Umgebungsgestein entstanden sind
Fahlerze: Sulfidische Kupfererzmineralien, hauptsächlich in hydrothermalen Erzlagerstätten; in der Bergmannssprache ein Sammelbegriff für umfangreiche Gruppe von komplexen Sulfid-Mineralien
Galenit: (Bleiglanz), chemisch Bleisulfid PbS
Gangart: Begleitmineralien die in einem Gestein oder im Erzen auftreten
Gebirgsdruck: Das infolge der Gesteinsüberlagerung Wirksamwerden von Spannungen im Gebirge beim Auffahren von Stollen oder Grubenbauen; kann zu Rissbildungen und Verbrüchen führen
Greenockit: Durch Verwitterung von cadmiumhaltiger Zinkblende entstandenes Mineral, chemisch Cadmiumsulfid CdS
Hangendes: Geologische und bergmännische Bezeichnung für Gesteine, welche eine Bezugsschicht bzw. die Abbauschicht überlagern
Hemimorphit: Mineral, ein Zinksilikat
Hydrothermal: Bildungsbereich von Mineralien aus gas- und/oder salzhaltigen, wässrigen Lösungen bei Temperaturen von 375°C bis ~ 30°C
Hydrozinkit: Ein sekundäres Zinkmineral, chemisch Zn5(CO3)2(OH)6
Imprägnationserz: Mineralvorkommen oder Lagerstätte, wo Erzminerale fein verteilt im Gestein eingesprengt auftreten
Jamesonit: Mineral, chemisch Blei – Antimon – Sulfid, Pb4FeSb6S14
Klastisch: Von griechisch „klasis“, Zerbrechen; mechanische Zertrümmerung von Gesteinen
Konkordanz: Ungestörte Überlagerung verschiedener Gesteinsschichten
Liegendes: Geologische und bergmännisch Bezeichnung für Gesteine, welche eine Bezugsschicht bzw. die Abbauschicht unterlagern
Metasomatose: Das Material eines Gesteins oder bestimmte Gesteinskomponenten werden aufgelöst und durch anderes Material verdrängt.
Miozän: Geologischer Zeitabschnitt der Erdneuzeit, jüngeres Tertiär, < 23 Mio. Jahre
Nebengestein: Das eine Gesteinsschicht oder Lagerstätte umgebende Gebirge
Paragenese: Charakteristische Vergesellschaftung verschiedener Mineralien an ihrem Bildungsort
Pseudomorphose: Auftreten eines Minerals in der Kristallform eines andern Minerals
Smithsonit: Mineral, chemisch Zinkkarbonat ZnCO3.
Sphalerit: Zinkblende
Syngenetisch: Bezeichnung für gleichzeitig mit dem Umgebungsgestein entstandes Merkal, beispielsweise einer Vererzung
Verwerfung: Die relative Verschiebung zweier Gesteinspakete längs einer tektonsichen Bewegungsbahn (geologische Störung), wodurch die ursprüngliche Lagerungsform eines Gesteins verändert wird
Zinkblende: Mineral, chemisch Zinksulfid ZnS, besitzt graue, gelbe, braune oder schwarze Farben; Blende ist ein alter Bergmannsbegriff für Täuschung, d.h. vielversprechend aussehend; siedet bei 907 °C, verdampft daher mit den Schmelzmethoden der Bleigewinnung; wurde in Destilationsöfen gewonnen; Bild Honigblende am Rand der weissen Calzit Ader.